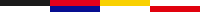Réunion des pays du Triangle de Weimar - Déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères de France, d’Allemagne et de Pologne (12 février 2024) -
À l’occasion de la réunion du Triangle de Weimar à La Celle-Saint-Cloud le 12 février 2024, nous, ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et de la...